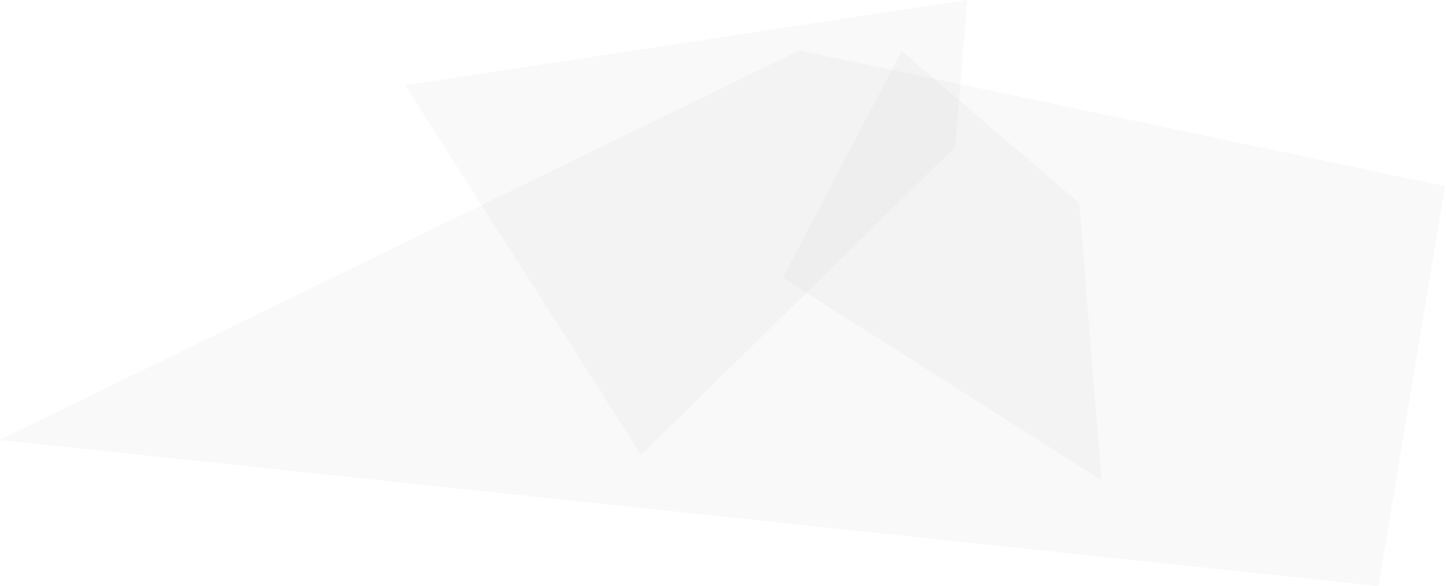Der Limesgedenkstein
Errichtet unter König Max II zur Erinnerung an den römischen Limes
Dem Wort Limes begegnet man in Kipfenberg recht häufig. Beispielsweise gibt es einen Limesweg, ein Gasthaus Limes, ein Limesfest und sogar eine Limeskönigin ….. Nun stellt sich natürlich die Frage, was es mit diesem „Limes“ auf sich hat. Lassen Sie uns mit der Suche nach der Antwort an einer Stelle beginnen, an der uns das Wort gleich mehrfach begegnet, nämlich am nördlichen Ausgang des Marktplatzes, hinter dem Gasthaus Limes. Dort steht an der Einmündung des Limesweges der Limesgedenkstein, eine Steinsäule mit quadratischem Grundriss auf einem niedrigen Treppensockel, errichtet im Jahr 1861 unter König Max II. von Bayern. Er trägt auf jeder der vier Seiten eine in den Stein gehauene und farblich ausgelegte Inschrift. Auf der einen Seite steht: „Gedenkstein“ „Landmarkung zwischen dem einstigen Reiche der Römer u. der Germanen Anfang am Haderfleck zwischen Hienheim u. Weltenburg Westliche Hauptrichtung durch Bayern und Würtenberg bis nach Rems u. Lorch sodann nordwestlich an den Main und den Rhein.“
Auf der nächsten Seite: „Der Pfahlrain kreuzt bei Denkendorf die Ingolstadt-Amberger Staatsstraße und zieht hier vorüber nach Pfahldorf, Hirnstetten an die Eichstätt-Gredinger Districktsstraße zwischen Wachenzell und Herlingshart“
Die dritte Seite sagt uns: „Der Pfahlrain Limes Danubianus, Vallum Hadriani, auch Probi später die Teufelsmauer genannt unter Kaiser Hadrianus angelegt u. unter Probus noch mehr befestigt.“
Und die vierte Seite erklärt: „Dieser Gedenkstein wurde errichtet unter König Max II im Jahre 1861“ Verlauf des Limes in Kipfenberg
Wir haben nun erfahren, dass der Limes zur Römerzeit die Grenzbefestigung zu den Germanengebieten war und dass er später auch „Pfahlrain“ genannt wurde, wodurch sich die Begriffe mit dem Wort „Pfahl“ erklären lassen, wie beispielsweise Pfahldorf und Pfahlbuck. Tatsächlich ist der Ort für diesen Gedenkstein sehr gut gewählt worden, denn der Limes lief genau hier an dieser Stelle vorbei. Wir können uns das besser vorstellen, wenn wir vom Gedenkstein aus den Limesweg überqueren, uns mit dem Rücken zum Eckhaus stellen und unseren Blick wieder auf den Stein richten. Zu Ihrer Linken sehen Sie nun den Limesweg bis zu dessen Ende. Von dort lief die Grenzbefestigung, von oben, vom Berg her kommend, an Ihnen vorbei die Försterstraße zu Ihrer Rechten entlang, überquerte bei der heutigen Altmühlbrücke den Fluss und lief dann hinter den Gebäuden der Schule die Anhöhe wieder hinauf. Von diesem Bergsporn mit dem Namen „Pfahlbuck“ ging es dann weiter in Richtung Pfahldorf.
Während der römischen Besatzungszeit im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus verlief also durch Kipfenberg die Grenzbefestigung des Römischen Reiches, sie wird als „Obergermanisch-Raetischer Limes“ bezeichnet. Die Teufelsmauer
Nach dem Alemannensturm, 233 nach Christus, verließen die Römer unsere Gegend und der Limes verfiel nach und nach. Bald waren die Reste für die Menschen eine unerklärbare und geheimnisumwobene „Teufelsmauer“.
Eine Reihe von Geschichtsforschern setzte sich mit diesem Thema auseinander, darunter auch Johannes Aventin, der sogenannte „Vater der bayerischen Geschichtsschreibung“. Aber so richtig Licht ins Dunkel der Limesgeschichte kam erst ab 1806 mit der Versetzung des Pfarrers Dr. Franz Anton Mayer ins nahe der Burg Kipfenberg gelegene Gelbelsee. Mit seinen ausgedehnten Wanderungen entlang des Limes begann erst die systematische Erforschung des bayerischen Abschnittes von der Donau bis zur Grenze nach Württemberg. Mayer wurde dadurch zum bedeutenden Limeskenner und legte mit seiner Dokumentation die Basis für alle weiteren Forschungen. Reichs-Limes-Kommission Im Jahr 1892 nahm die „Reichs-Limes-Kommission“ mit dem sogenannten „Streckenkommissar“ Dr. Friedrich Winkelmann aus Pfünz ihre Arbeit im Streckenabschnitt Kipfenberg auf, setzte die systematische wissenschaftliche Erforschung des Limes fort und brachte uns einen großen Teil des heutigen Wissens um den Limes und das römische Leben in der Kipfenberger Gegend. Wenn Sie sich noch genauer informieren möchten, so besuchen Sie doch unser Römer- und Bajuwarenmuseum oben an der Kipfenberger Burg. Mit dem „Infopoint Limes“ finden Sie dort eine einmalige Ausstellung zum Thema „Römisches Leben am Limes“. Sie können auch den rekonstruierten Limesturm auf dem Pfahlbuck besichtigen, das ist der Bergsporn am Ortsausgang links in Richtung Pfahldorf. Von der Straße mit dem Namen Sonnenleite aus führt ein schöner Wanderweg hinter der Schule entlang nach oben. Sie finden auch eine Infotafel zum Thema „Limes in Kipfenberg“ und können sich anhand eines rekonstruierten Palisadenzaunes recht gut vorstellen, wie der Limes damals in der Landschaft ausgesehen hat.
Text: Werner Kränzlein, 10.03.2025
Sprecher: Werner Kränzlein
Produktion: Landvilla-Audio Kipfenberg
Mit freundlicher Unterstützung durch Dr. Karl Heinz Rieder, Kreisheimatpfleger, wissenschaftlicher Leiter des Römer- und Bajuwarenmuseums Kipfenberg
Quellenangaben:
Rieder, Karl Heinz: Kipfenberg, Römer und Bajuwaren im Altmühltal, 2020, Verlag Friedrich Pustet Regensburg, ISBN 978-3-7917-3092-9
Mayer, Franz Anton: Genaue Beschreibung der unter dem Namen der Teufelsmauer bekannten Römischen Landmarkung / 1. Von der Donau bis Kipfenberg, 1824 Bayerische Akademie der Wissenschaften [Verlag], München